Ein Jahr nach Hanau: Suche nach Antworten

Wut, Trauer und Frust. Der 19. Februar 2020, an dem in Hanau neun Menschen von einem Rechtsextremisten ermordet wurden, ist ein dunkles Kapitel im Kampf gegen rechte Gewalt in der Geschichte Deutschlands. Dann kam die Corona-Pandemie und verdrängte die mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit für die Morde von Hanau. Im Spotify-Podcast „190220 – Ein Jahr nach Hanau“ von ABC Stories arbeiten Sham Jaff und Alena Jabarine nicht nur die Ereignisse auf, sondern lassen auch Freunde und Familie der Opfer sowie Überlebende des Anschlags zu Wort kommen.
Der Podcast „190220 – Ein Jahr nach Hanau“ ist für den Grimme Online Award 2021 in der Kategorie „Information“ nominiert. Im Interview erzählt Alena Jabarine, wie die Resonanz der Betroffenen auf den Podcast war und welcher Moment vor Ort sie am meisten bewegt hat.
Sie erwähnen am Anfang des Podcasts, dass Hanau aufgrund anderer Ereignisse mit hoher Medienaufmerksamkeit, nicht zuletzt wohl der Corona-Pandemie, im Jahr 2020 in den Hintergrund rückte und nicht die Aufmerksamkeit bekam, die das Thema verdient. Wir müssen gestehen: Als wir Ihren Podcast unter den Nominierten sahen, hatten wir den 19.02.2020 schon fast vergessen. Inwiefern ist Ihr Podcast ein Beitrag dazu, dass die Erinnerung an die Ereignisse von Hanau – hoffentlich – bleibt?
Ich glaube, dass unser Podcast da tatsächlich – und darüber bin ich auch sehr, sehr, sehr glücklich – einen großen Beitrag geleistet hat. Vor allem, weil Podcast ja eine ganz andere Art von Medium ist und andere Menschen erreicht. Es gibt viele junge Menschen, die sich sehr für politische oder gesellschaftliche Themen interessieren, aber die Themen oft in den klassischen Medien nicht wiederfinden. Das habe ich anhand der Reaktionen gemerkt, die ich bekommen habe oder meine Kolleg*innen über Social Media. Unglaublich viele Menschen haben mir, aber auch Sham zum Beispiel geschrieben, wie glücklich sie darüber sind, dass wir dieses Thema aufgegriffen haben, dass wir darüber reden, dass wir vielleicht auch mutig darüber reden. Dass wir gewisse Dinge ansprechen, eben sagen, Hanau war kein Einzelfall. Und dass sie sich darin total wiedergefunden haben, ist auch sehr viel geteilt worden, vor allem von jungen Menschen. Das hat mir einfach gezeigt, dass das etwas war, worauf viele gewartet haben oder was viele sich gewünscht haben.
Mit Ihren interviewten Expert*innen sprachen Sie nicht nur über die Ereignisse in Hanau, sondern auch über die Entwicklung und Auswirkungen rechter Gewalt. Gab es daraufhin auch rechte Kommentare?
Ich glaube schon, dass etwas dabei war. Aber es ist mir nicht so in Erinnerung geblieben. Ich glaube, dass die Mehrheit der Kommentare tatsächlich eher positiv war. Ich kann mich nicht an einen großen, rechten Shitstorm erinnern, zumindest nicht mir gegenüber. Meine Kolleg*innen haben das auch nicht erzählt. Klar, wir wissen alle, wie Social Media funktioniert, die eine oder andere schlimme Nachricht ist immer dazwischen. Aber ich habe noch nie etwas journalistisch gemacht, das ausschließlich so positive Reaktionen bekommen hat. Gerade bei schwierigen Themen ist man ja eigentlich gewöhnt, auch als Journalistin, dass sie sehr unterschiedlich diskutiert werden und dass auch oft viel Hass mit dabei ist. Bei dieser Thematik war die Reaktion seltsamerweise wirklich positiv. Zum Glück. Vielleicht haben die sich bei uns nicht getraut.
Das freut uns auch sehr. Man weiß ja, wie schnell heutzutage so etwas auf Social Media passiert.
Stimmt. Aber das hat mich wirklich gewundert. Jetzt, wo Sie das fragen: Wir haben darüber gesprochen, es ist schon wieder ein bisschen her; aber ich weiß noch, dass ich gesagt habe, wie sehr ich mich wundere, dass die Reaktionen so positiv sind. Wir haben für den Podcast auch Umfragen auf der Straße gemacht. Ich war auch in Hanau unterwegs, und da hatte ich den einen oder anderen NPD-Menschen vor meinem Mikrofon. Es ist ja nicht so, dass diese Menschen nicht existieren, die irgendwie der Meinung sind, man wüsste ja gar nicht, ob das rassistisch sei, und das hätte vielleicht ganz andere Motive. Das habe ich schon auch alles gehört, auch während der Umfragen. Aber die Reaktion auf den Podcast direkt war tatsächlich, zum Glück, größtenteils sehr positiv.
Die Ereignisse in Hanau waren ein schreckliches Beispiel für rechte Gewalt in Deutschland. Wie bereits erwähnt, überschattete unter anderem die Corona-Pandemie die weitere Berichterstattung über die Ereignisse. Finden Sie dennoch, dass die Ereignisse das Bewusstsein über rechte Gewalt in der Bevölkerung geschärft haben?
Ich würde gerne sagen: Ja. Aber ich glaube eher: Nein. Erstmal ist das ja menschlich: Es passieren Dinge, die Leute regen sich auf und sind traurig und dann ist es ganz schnell auch wieder vergessen. Das kennt man auch von sich selbst. Ich glaube, dass das für viele Menschen auch in Bezug auf Hanau so ist. Andererseits, um auch etwas Positives zu sagen: Ich glaube, dass Hanau schon besonders war im Vergleich zu anderen rechtsradikalen Anschlägen, dass doch viel in Bewegung geraten ist. Es ist sehr viel aufgegriffen worden, auch von jungen Menschen, auch künstlerisch. Man hat in vielen großen Städten die Poster, die Bilder der Opfer gesehen. #saytheirnames, das Hashtag. Es gab viele Proteste, Kundgebungen; vor allem auch in Hanau selbst sind ja die Angehörigen gemeinsam mit Unterstützer*innen bis heute sehr aktiv. Das ist vielleicht etwas Positives, was man anmerken kann, da war Hanau etwas anders. Wir haben analysiert, dass es vielleicht daran liegt, dass Hanau ein bisschen ein Angriff auf die junge Generation war. Vielleicht anders als beim NSU, als man klassische Gastarbeiter*innen treffen wollte, wollte man hier wirklich eher junge Menschen treffen, die oftmals auch in Deutschland geboren waren, schon teilweise in der zweiten Generation, wie z.B. Hamza. Insofern hat sich das schon, glaube ich, in bestimmten Kreisen anders eingeprägt. Es hat mir persönlich gut getan zu sehen, dass viele Leute in meinem Umfeld sehr wahrgenommen haben, was passiert ist. Wenn wir über Gesamtdeutschland reden wollen: Ich habe auch viel Kontakt zu Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben. Ich bin selbst halb Deutsche; wenn ich meine deutsche Oma fragen würde: „Was hat Hanau mit dir gemacht?“ – wahrscheinlich nicht so viel. Unterm Strich glaube ich schon, dass Hanau vielleicht doch eher in bestimmten Kreisen besonders wahrgenommen wurde. Aber vielleicht ist das ja ein guter Anfang.
Durch die Interviews mit Betroffenen erforderte die Arbeit am Podcast ein hohes Maß an Sensibilität. Wie war die Resonanz der interviewten Betroffenen auf die Zusammenarbeit und das Ergebnis?
Also wirklich extrem gut. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das sage, bis heute schreiben sie mir. Die Familienangehörigen sind tatsächlich – unabhängig von der Situation, in der sie sich befinden – ganz besondere Menschen, von denen ich am Ende gesagt habe: Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen kennengelernt. Ich mochte sie einfach und ich glaube, sie haben gespürt, dass wir ein wirklich aufrichtiges Interesse hatten. Wir waren ja nicht die Bild-Zeitung, die ihnen am Tag nach dem Anschlag die Kamera ins Gesicht hält, sondern wir sind zu zweit mit unserem kleinen Aufnahmegerät dagewesen. Wir haben sie erst einmal kennengelernt, sind langsam ins Gespräch gekommen und ich glaube, sie haben gemerkt und verstanden, was Podcast bedeutet. Dass wir ihnen Raum geben wollen und dass es nicht darum geht, ein krasses Statement zu bekommen, sondern dass wir sie wirklich kennenlernen wollen und dass wir wollen, dass die Zuhörer*innen die Menschen kennenlernen und in dem Moment mit ihnen fühlen können. Sie haben uns vertraut. Zum Glück.
Wir waren natürlich auch bei Hamzas Eltern zu Hause. Das war extrem schwer, auch für uns und für mich als Reporterin. Man fühlt sich schlecht, weil man in einer so frischen Wunde wühlt. Als wir da waren, war der Anschlag gerade zehn Monate her. Man redet mit Menschen, die ihre Kinder, ihre Brüder verloren haben. Ich habe wirklich viele Interviews in meinem Leben geführt, auch zu schwierigen Themen; aber zum ersten Mal ist mir an der einen oder anderen Stelle im Interview eine Träne runtergelaufen. Den Angehörigen der Opfer ging es auch nicht gut, aber sie hatten ein Interesse, mit uns zu sprechen, deswegen war das so schön. Sie wollten, dass die Geschichte erzählt wird. Sie wollten ihre Perspektive laut machen. Sie wollten, dass ihre getöteten Angehörigen nicht in Vergessenheit geraten. Wir hatten alle ein Interesse daran, dass das irgendwie gut wird und dass das viele Menschen erreicht. Sie waren sehr glücklich darüber und auch sehr stolz auf das Ergebnis. Und das war für uns auch das Allerwichtigste.
Der erste Tatort war bzw. ist ein zentraler Ort für alle Betroffenen. Von der Initiative 19. Februar in eine Anlaufstelle umgewandelt, konnten Sie in diesem Raum viele der Betroffenen kennenlernen und interviewen. Wie war es für Sie, dort zu arbeiten?
Für uns als Journalist*innen war es ein Segen, dass es diesen Raum gab. Während des Lockdowns, als alles geschlossen war, wäre es schwierig gewesen, ohne diesen Raum Menschen zu treffen. Dazu war es kalt, es war Dezember, draußen im Park hätte es auch nicht funktioniert. Logistisch war es superpraktisch, diesen Raum zu haben. Dieser Raum ist, um es in den Worten von Mercedes‘ Vater zu sagen, zum Wohnzimmer für die Angehörigen geworden. Es ist ein sehr schöner Ort – groß, hell, freundlich. Die Angehörigen sprechen dort über ihr weiteres Vorgehen, über Strategien oder auch mal mit ihren Anwält*innen; aber sie hängen dort auch teilweise einfach ab. Mercedes ist eines der Opfer, sie war die einzige Frau, die getötet worden ist; ihr Vater und ihr Sohn sind dort viel zusammen. Ihr Sohn kommt nach der Schule dahin und hängt da ab. Dort ist er von Menschen umgeben, die seinen Schmerz teilen, die ihn verstehen, denen er nicht alles erklären muss. Es sind regelmäßig viele Angehörige dort, eigentlich alle, wenn sie in Hanau sind. Es ist ein „come and go“. Dann gibt es aber auch Unterstützer*innen oder auch Passanten, die einfach mal reinkommen. Es ist ein Ort, der uns sehr geholfen hat, weil wir erst einmal hingegangen sind und mit Menschen ins Gespräch gekommen sind. So konnten die Gespräche quasi entstehen, weil die Angehörigen uns gesehen haben, man hat sich schon mal vorgestellt. Irgendwann habe ich mich neben Mercedes‘ Vater gesetzt und gefragt: „Können wir uns vielleicht mal unterhalten? Wir machen einen Podcast.“ Ich musste erst mal erklären, was Podcasts sind; das wissen viele ältere Leute nicht und denken, dass das niemanden erreicht. Es war sehr gut, diesen Ort zu haben; für uns als Journalistinnen war es für die Arbeit perfekt. Und für die Angehörigen ist dieser Ort, glaube ich, ein totaler Safe Space und einfach der einzige Ort, an dem sie das Gefühl haben, in ihrem Schmerz verstanden zu werden.
Eine wichtige und oft gestellte Frage war, ob die Behörden Ihrer Meinung nach alles getan haben, um die Tat zu vermeiden. Wie ist im Rückblick Ihre persönliche Meinung dazu?
Das ist eine sehr schwierige Frage. In intensiven Gesprächen waren vielen Expert*innen, unter ihnen auch eine Anwältin, die Angehörige des NSU-Prozesses vertreten hat, einhellig der Meinung, dass die Polizei mehr hätten machen können, um es zu verhindern. Ob man es am Ende hätte verhindern können, kann man natürlich nicht sagen. Es gibt aber gewisse Dinge, die anders hätten laufen können, z.B. hätte der Täter keine Waffenbesitzkarte haben müssen. Man weiß am Ende natürlich nicht, ob er sich dann nicht trotzdem illegal eine Waffe besorgt hätte. Man kann eigentlich nur spekulieren. Was jedoch klar ist: Die Behörden hatten ihn offensichtlich nicht wirklich als Gefahr auf dem Zettel. Obwohl es nach unserer Meinung und der Meinung unserer Expert*innen viele Anhaltspunkte hätte geben müssen, die dazu hätten führen können, dass vielleicht der eine oder andere Behördenmitarbeiter gesagt hätte: „Da schauen wir nochmal genauer hin“; weil diese Person im Vorfeld der Tat auf sich aufmerksam gemacht hat. Es kommen einige Dinge zusammen, die vermutlich für die Angehörigen noch mal besonders schmerzvoll sind, weil sie sich jetzt natürlich fragen: „Hätte dieser Mensch keine Waffenbesitzkarte gehabt, würde dann mein Kind noch leben?“ Hundertprozentig werden wir es nicht wissen. Natürlich haben wir auch da den Finger in die Wunde gelegt; es geht auch um strukturellen Rassismus und um die Frage, ob deutsche Behörden für Terror von rechts genug sensibilisiert sind, oder ob da nicht oft gedacht wird: „Ach, das ist jetzt einfach irgendein Irrer, der schreibt uns hier irgendwelche komischen Verschwörungs-Fantasien. Das legen wir mal auf den Stapel der Briefe von Geistesgestörten.“ Dass da nicht die Alarmglocken geläutet haben, hat meine Kolleg*innen und mich am Ende zu dem Schluss kommen lassen, dass zumindest auf Behördenseite noch nicht genug Sensibilität vorhanden ist. Das Problem des rechten Terrors in Deutschland ist in seinem Ausmaß auf vielen Ebenen offensichtlich noch nicht bekannt – oder vielleicht teilweise bekannt, wird aber bewusst nicht gesehen. Ob es auch Rassismus innerhalb von Behörden gibt, ist wie gesagt Spekulation. Aber da muss man, glaube ich, sehr genau hingucken. Ich hoffe, dass unser Podcast dazu auch einen Beitrag leisten konnte.
Der Podcast besteht aus insgesamt sechs Episoden und einer Kurzepisode anlässlich des Jahrestags der Ereignisse. Gab es eine Episode, die für das Team eine besondere emotionale Belastung darstellte?
Die emotionalsten Momente waren immer die Interviews mit den Angehörigen. Für mich persönlich war das Folge 4, „Born and raised in Kesselstadt“. Ich war dort unterwegs und habe mit jungen Leuten gesprochen. Das hat mich krass mitgenommen, noch mal anders als die Gespräche mit den Eltern von Getöteten. Ich habe mir ein bisschen Sorgen um die Zukunft gemacht, weil ich junge Leute getroffen habe, von denen viele das Gefühl hatten: „Okay, alles klar. Das hat jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht. Jetzt habe ich gecheckt, ich gehöre nicht in diese Gesellschaft. Ich bin zwar hier geboren und habe vielleicht auch mal versucht dazuzugehören. Aber spätestens jetzt ist mir klar: Ich werde niemals dazugehören und deswegen scheiß‘ ich jetzt auch einfach drauf. Sie sollen ihr Ding machen. Ich mach mein Ding, aber wir gehören nicht zusammen.“ Das hat mich zwar traurig gemacht, aber ich konnte das aus deren Perspektive total nachvollziehen.
Es war ein bisschen Zufall, auf wen wir dort getroffen sind. Wir waren bei dem Jugendzentrum, das Herz in Kesselstadt, mit dem viele der Getöteten aufgewachsen sind. Wir haben da mit Angehörigen und jugendlichen Freunden der Opfer gesprochen. Es waren kurze Treffen mit intelligenten, coolen jungen Männern, von denen ich mir wünschen würde, dass sie Teil dieser Gesellschaft werden. Sie selbst haben aber eigentlich aufgegeben und fühlen sich vor allem auch dadurch verhöhnt, dass der Vater des Täters immer noch ein paar Meter von ihnen entfernt wohnt und Polizeischutz bekommt. Viele von ihnen haben Gefährderansprachen bekommen, wurden von der Polizei darauf aufmerksam gemacht, sich zurückzuhalten. Das war für viele nochmal ein Schlag ins Gesicht. „Wir sind hier die Opfer, nicht der Vater des Täters“, meinten viele. Der Vater des Täters soll zwar nicht in Kollektivhaftung genommen werden, aber es wurde berichtet, dass er durchaus rechtes Gedankengut vertrete und die Tat seines Sohnes verharmlost oder sogar unterstützt habe. Zumindest, soweit wir wissen. Dass er dort immer noch wohnt, haben viele als Provokation empfunden, und zwar nicht nur vonseiten des Vaters, sondern auch vonseiten der Behörden. Dass ihnen das zugemutet wird, fand ich traurig. Um trotzdem noch mal etwas Positives zu sagen: Wir haben z.B. mit Said Etris, dem Bruder von Said Nesar Hashemi gesprochen, zehn Monate, nachdem er seinen Bruder verloren hatte. Said Etris war dabei, als sein Bruder getötet wurde, er wurde selbst schwer verletzt, hatte Schusswunden im Hals. Man würde verstehen, wenn er voll von Hass und Wut wäre, doch er war so diplomatisch und konstruktiv, dass ich völlig überrascht war. Er hat gesagt: „Wir schaffen das. Wir hatten so viel Unterstützung, auch von deutsch-deutschen Bürgern, Nachbarn. Hanau ist meine Stadt. Ich bin hier aufgewachsen und wir schauen jetzt nach vorne und sorgen dafür, dass die Rassisten nicht gewinnen.“ Ich fand extrem beeindruckend, dass die Leute so kurz nach der Tat nicht voll von Wut und Hass waren, sondern eher gesagt haben: „Wir machen jetzt konstruktive Arbeit, wir machen jetzt Medienarbeit, wir machen Kundgebungen, wir sorgen dafür, dass unsere Kinder, Brüder nicht in Vergessenheit geraten.“ Ich wüsste nicht, ob ich diese Stärke gehabt hätte.

Screenshot Zoom-Interview mit Alena Jabarine
Das Interview führten Marlon Butz und Kevin dos Reis Almeida. Die Interviews entstanden in medienpraktischen Übungen im Bachelor-Studiengang „Mehrsprachige Kommunikation“ an der TH Köln.



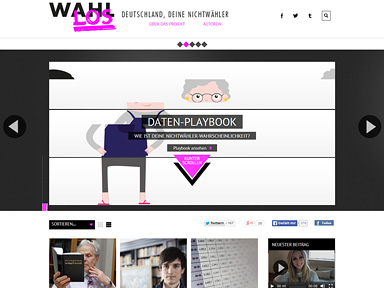

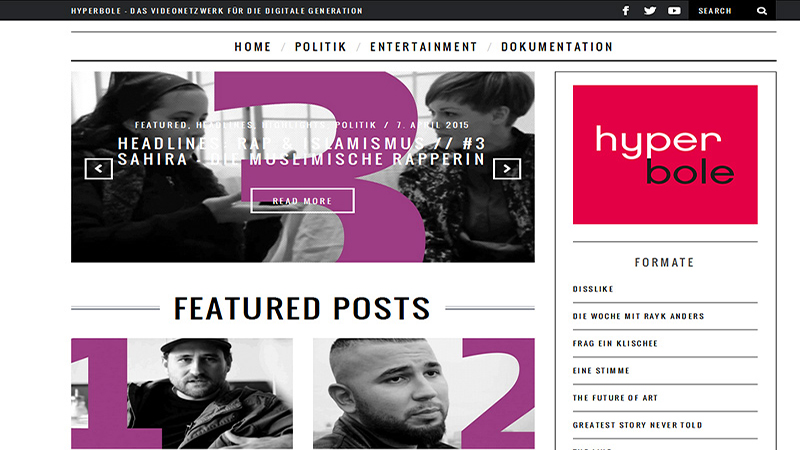



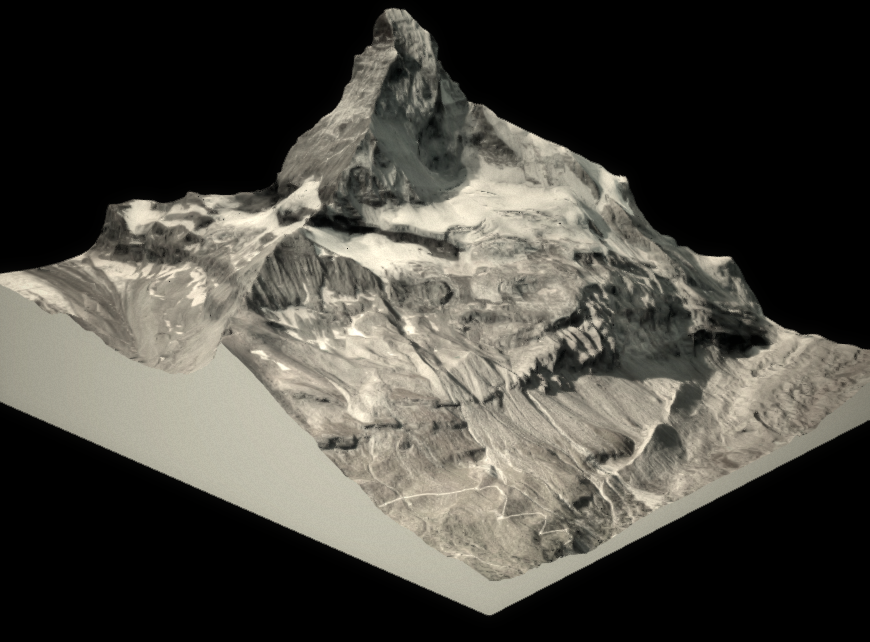
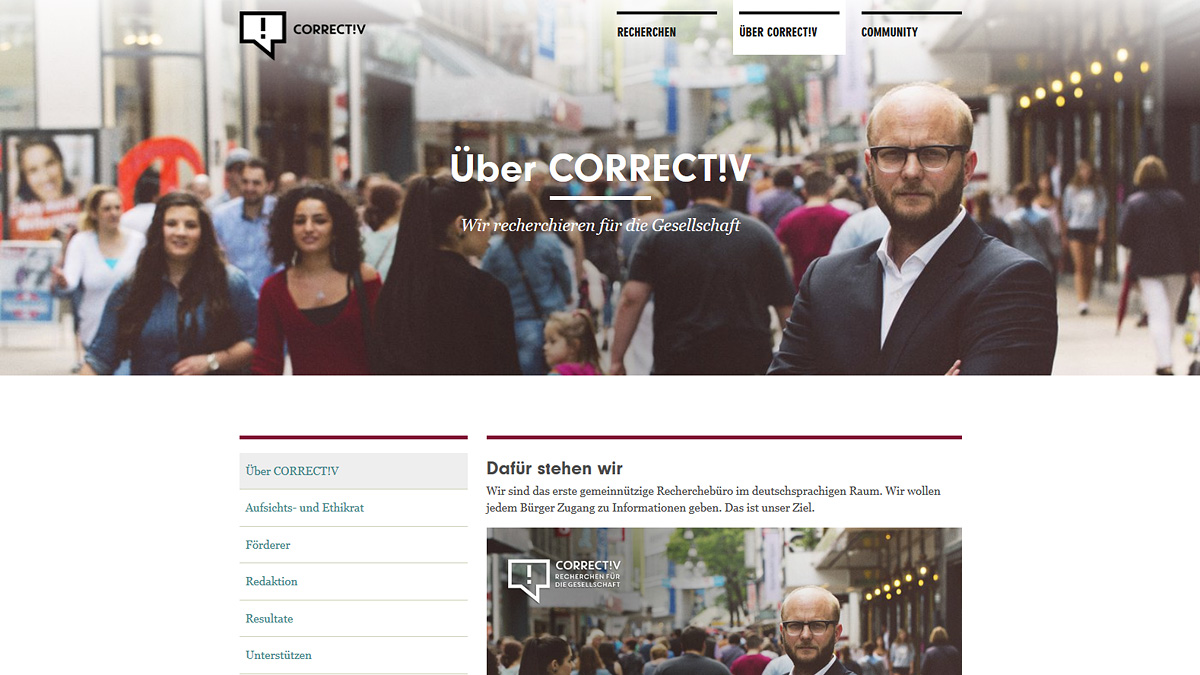


Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!