Rechtspopulismus klug analysiert
„Ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem mit Extremismus und dem Kampf gegen Extremismus“, steigt Stephan Anpalagan im ersten Talk des Social Community Day ein und zeigt so auf, warum es den Tag unter dem Titel „Nach dem Rechten schauen“ überhaupt gibt: Rechtsextremismus und Rechtspopulismus existieren, sie vergiften die Gesellschaft und sie gehen auch nicht von alleine weg. Deshalb hatten wir zum Social Community Day Menschen eingeladen, die sich damit auseinandersetzen und aktiv dagegen angehen.

Kurzfristige Planänderung
So weit der grundsätzliche Gedanke. Inhaltlich sind wir auch dabei geblieben, an der Form hat sich allerdings im Verlauf der Zeit – und der Pandemie – viel verändert. Aber wir sind ja flexibel. Dass wir eine Veranstaltung ohne Publikum nur als Livestream machen würden, war von Anfang an klar. Aber wir wollten eigentlich zumindest die Referentinnen und Referenten vor Ort haben, und unseren Moderator Michel Abdollahi natürlich. Aber dann kam ein starker Anstieg der Infektionszahlen und darauf folgend neue Corona-Regeln. Auch wenn wir unsere Veranstaltung wie geplant hätten durchführen können, fühlte es sich doch falsch an, die Menschen quer durch die Republik reisen zu lassen. Also haben wir umdisponiert. Und so sitzen wir am 4. November zu Hause oder im Grimme-Institut und begrüßen unsere Referentinnen und Referenten im Warteraum über das allseits bekannte Interface von Zoom. Der Diskussionsfreudigkeit schadet das nicht.
Social Media ist nicht schuld
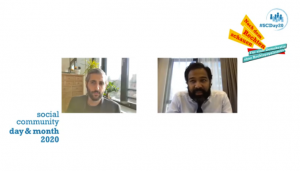
Stephan Anpalagan, der sich auf Twitter und Facebook gegen Rassismus und Rechtspopulismus engagiert und Handlungen wie Ereignisse klug analysiert, wischt im ersten Panel gleich die Fragestellung nach der „Zivilcourage in sozialen Medien“ weg. „Als ob irgendwas schlimmer geworden wäre, weil Twitter und Facebook existieren“, meint er, „das ist doch auch nur so eine Ausgrenzung und Rechtfertigungsstrategie. Um vielleicht auf eigene gesellschaftliche Belange nicht schauen zu müssen. Und sich nicht zu überlegen, welche Verantwortung Medienmacher, Politikschaffende und Menschen haben, die Meinungsmultiplikatoren sind und Deutungshoheit haben.“ Er sieht dagegen massive gesellschaftliche Probleme: „Es gibt ein unglaubliches Problem mit fehlender Diversität in Politik und Medien. Es fehlen Stimmen, nicht nur der Zuwanderer. Es fehlen Frauen, es fehlen Arme, es fehlen Menschen mit Behinderung, es fehlen Schwule. Alles Menschen, die Teil dieser Gesellschaft sind und die einfach nicht mitmachen in diesem Diskurs und in der Debatte und die vielleicht auch einen neuen Gedanken mitbringen.“
Instrumentalisierung von Fakten
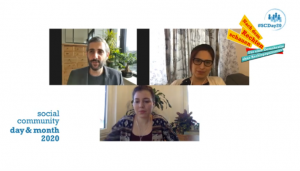
Im nächsten Panel trifft Natascha Strobl, die auf Twitter mit #NatsAnalysen rechte Kommunikationsstrategien entlarvt, zumindest virtuell auf Uschi Jonas, Faktencheckerin beim Recherchekollektiv CORRECTIV. „Mit Fakten gegen Rechts“ ist die Begegnung überschrieben. Doch: „man sieht immer mehr, dass es immer mehr Menschen gibt, die Fakten nicht glauben und Fakten nicht als das, was sie sind, nehmen“, stellt Uschi Jonas gleich zu Beginn fest. Und Natascha Strobl stellt klar, dass auch Rechte Fakten für ihre Zwecke nutzen: „Sie schaffen Gegenfakten, Gegenwahrheiten. Und das ist das Problem, dass sie aus dem Kontext gerissene oder schlicht falsche Fakten nehmen und sie den anerkannten und nach einer guten wissenschaftlichen Methode zustande gekommenen Fakten gegenüberstellen. Und damit schaffen sie Verwirrung.“ Doch bei welchen Alarmsignalen sollte man aufmerken? Neben vielen anderen warnt Uschi Jonas vor zu einfachen Antworten: „Leute, die bewusst Desinformationen verbreiten, haben es super leicht, weil deren Strategie oft ist, eine ganz einfache Antwort auf komplexe Dinge zu liefern. Allein das ist schon oft ein Zeichen, wo man stutzig werden sollte.“ Und zum Abschluss rät Natascha Strobl: „Das Wichtige ist, immer weiter Fragen zu stellen, immer in der Debatte bleiben, immer in der Diskussion bleiben.“
Erschreckende Kontinuität
Caro Keller und Nora Hespers beschäftigen sich beide damit, wie man aus der Vergangenheit für die Gegenwart und die Zukunft lernen kann – und so heißt ihr Panel auch „Vergangenheit und Gegenwart im Kontext„. Bei Caro Keller ist es die jüngere Vergangenheit, denn sie arbeitet für „NSU-Watch„, wo im Detail über die Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds aufgeklärt wurde, wo aber auch aktuell über Taten, Prozesse und Untersuchungen im Kontext rechten Terrors berichtet wird. Nora Hespers forscht in ihrem privaten Projekt „Die Anachronistin“ zu ihrem Großvater, der als Widerstandskämpfer von den Nationalsozialisten ermordet wurde und sieht eindeutige Parallelen zur heutigen Zeit: „Wir müssen die Entwicklungen im Auge behalten. Auch im Journalismus – wir machen häufig Schlaglicht-Journalismus und bleiben selten dran. Das heißt, wir können ganz wenig Entwicklungen nachvollziehen und plötzlich fällt einem auf: das gab es schon einmal.“ Und auch Caro Keller plädiert für eine Tiefe in Berichterstattung und Rezeption: „Diese Verkürzungen, die stattfinden, dass beispielsweise immer von Einzeltätern die Rede ist, oder von ganz unerwarteten Ereignissen, führt dazu, dass man rechtem Terror nichts entgegenzusetzen hat. Wir müssen verstehen, dass es eine Kontinuität rechten Terrors gibt. Wir müssen verstehen, dass es eigentlich immer wieder ähnlich funktioniert.“ Sie appelliert an die Medien, aus eigenen Fehlern im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex zu lernen. Die Medien sollten „kritischer berichterstatten darüber, was passiert und auch das Handeln der Behörden, des Verfassungsschutzes, aber auch der Polizei kritisch hinterfragen und das eigene Wissen über rechten Terror“ ausschöpfen. Caro Keller sieht aber tatsächlich Fortschritte, gerade aktuell auch in der Berichterstattung über den Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle: „Da weiß man, wenn man die Bilder vom Täter zeigt, wenn man dessen Ideologie eins zu eins wiederholt, dass man ihm hilft. Er möchte durch seinen Auftritt vor Gericht andere zu gleichen Taten inspirieren. Deswegen haben sich einige Medien entschieden, seinen Namen nicht zu nennen, sein Bild nicht zu zeigen und das, was er sagt, nicht einfach eins zu eins nochmal in die Welt rauszugeben, obwohl das eigentlich genau der Medienlogik entspricht, weil es sehr skandalös ist, was er sagt.“ Genau ein solches Handeln wünscht sich auch Nora Hespers, insbesondere wenn Medien auf Social-Media-Plattformen unterwegs sind: „Dass noch mehr gelernt wird, wie funktioniert das in den sozialen Medien, wie funktionieren Troll-Aktionen, aber auch wie mache ich mich nicht zum Instrument von Rechtspopulisten. Wie gebe ich nicht einfach deren Aussagen unreflektiert weiter, selbst dann, wenn ich nur die Kürze von einem Tweet habe.“
Rassismus benennen
Im nächsten Panel geht es um „Recherche: Mitten in der Gesellschaft?„. Anh Tran hat für den Deutschlandfunk die Reportage „Mein Dresden – Heimat tut weh“ mit ihren Verwandten und Freunden in Dresden auch über Rassismus und rechte Strömungen gesprochen, Julian Feldmann recherchiert seit Jahren in der rechten Szene und berichtet darüber unter anderem für den NDR. Beide sehen eine Zurückhaltung in den Medien bei der richtigen Bezeichnung. So gebe es viel Berichterstattung über Rechte und Rassisten, schildert Julian Feldmann seine Erfahrungen, es werde aber oft davor zurückgeschreckt, Rechtsextreme und Rassisten auch als solche zu benennen. Und Anh Tran schildert ihre eigene Erfahrung in einem ganz konkreten Fall: „Wenn ich an Hanau denke, hieß es am Anfang wieder in vielen Medien ‚fremdenfeindlicher Angriff‘, ‚fremdenfeindlicher Mord‘. Mich hat es wirklich geschüttelt an dem Tag. Und wie mir ging es auch anderen nicht-weißen Deutschen, die gesagt haben, das war nicht fremdenfeindlich, das war rassistisch. Und das macht einen Unterschied. Da haben wir eine Verantwortung.“ In der Recherche allerdings solle man nicht sofort in die harte Konfrontation gehen, sind sich beide einig. „Natürlich muss man sich auch Rassisten und anderen Menschenfeinden, wenn man darüber recherchieren will, ein Stück weit offen nähern“, schildert Julian Feldmann seine Erfahrungen. Das ändere aber nichts daran, dass man im journalistischen Produkt später auch Klartext sprechen müsse. Und Anh Tran bestärkt: „Gegen Diskriminierung, also antirassistisch zu denken, ist keine Meinung, sondern ist eine Haltung, die auch durch das Grundgesetz gestärkt wird.“
Breites Meinungsspektrum als Diskursgrundlage
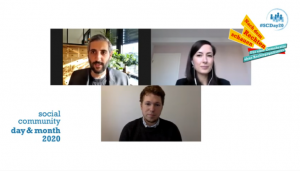
Soll man Rechte zu Wort kommen lassen oder nicht? Müssen wir rechte Haltungen und Meinungen zwingend in den Medien abbilden? Dieser Frage widmen sich in „Mit Rechten reden?“ die Kommunikationswissenschaftlerin Nadia Zaboura und Jan-Henrik Wiebe vom öffentlich-rechtlichen Jugendangebot „funk„, wo bis Ende August die ehemalige AfD-Jungpolitikerin Franziska Schreiber einen eigenen Kanal hatte. Nadia Zaboura stellt gleich zu Beginn klar: „Wir haben in unserer Demokratie eine Freiheit auf Meinungsäußerung, die ist aber nicht identisch mit der Freiheit jederzeit und überall eine mediale Plattform erhalten zu müssen.“ Sie plädiert dafür, ein möglichst breites Meinungsspektrum abzubilden, dies aber auch einzuordnen. Und Jan-Henrik Wiebe berichtet über den Prozess innerhalb der Redaktion: „Wir fragen uns natürlich auch: haben wir einen Bias, bevorzugen wir manche Gruppen, bilden wir konservative Meinungen oder auch rechte Meinungen ab in unserem Programm? Aber genauso fragen wir uns auch, bilden wir Migrantinnen genügend ab, bilden wir liberale Meinungen, linke Meinungen genügend ab. Und da schauen wir immer, dass wir ein möglichst ausgewogenes Programm gestalten.“ Stimmen aller gesellschaftlichen Stimmen, quer durch alle Alterskohorten abzubilden sei wichtig, stimmt Nadia Zaboura zu, als Grundlage für einen gemeinsamen Diskurs. „Das ist eine Riesenaufgabe“, so Zaboura, „die die Medien gar nicht alleine stemmen können. Das liegt daran, dass in so einer fragmentierten Medienöffentlichkeit, in der wir uns gerade befinden, wir eigentlich nicht mehr das gemeinsame Lagerfeuer haben an Diskussionen.“ Schwierig sei es oft aber auch, berichtet Jan-Hendrik Wiebe, im journalistischen Prozess überhaupt alle Personen zu Wort kommen zu lassen: „Wenn wir das Thema Rechtsextremismus behandeln, dann versuchen wir die Personen, die wir investigativ beobachten, auch zu Wort kommen zu lassen, eine Stellungnahme von ihnen zu bekommen. Allerdings wollen sie oft gar nicht mit uns reden.“ Genau solche Berichte aus der journalistischen Arbeit sind für die Nutzerinnen sehr wertvoll. Die Medien könnten nicht „jede Partikularmeinung abbilden“, stimmt Nadia Zaboura zu, „da sollte man mit starkem Rücken zeigen: es gibt Dinge, die wir nicht abbilden können und wollen – und darüber bitte mehr Transparenz schaffen. Also wirklich Berichte aus dem Maschinenraum des Journalismus.“
Sehen und gesehen werden
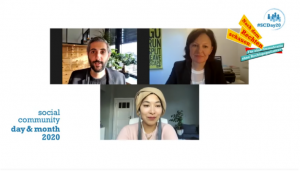
In den vorherigen Gesprächen klang es immer wieder an, jetzt ist es zentraler Punkt: „Vielfalt in Redaktionen und Themen„. Darüber sprechen die Integrationsbeauftragte des Westdeutschen Rundfunks Iva Krtalic und Esra Karakaya, Moderatorin des Instagram-Talkformats „Karakaya Talks“ – und amüsieren sich gleich zu Beginn über die Fragestellung, was die Sichtbarkeit unterschiedlicher Gruppen in den Medien bewirken könne. „Die Sichtbarkeit von unterschiedlichen Menschen hat einen Einfluss auf die Gesellschaft, auf Strukturen oder auch auf Gesetze“, sagt Esra Karakaya ganz klar. Auch Iva Krtalic sieht eine „gleichberechtigte, offene Partizipation“ in allen Bereichen einer pluralen Gesellschaft als Grundlage für Veränderung. „Wenn wir ein realitätsnahes Bild dieser Gesellschaft auf den Bildschirmen und in den Programmen zeigen“, so Iva Krtalic, „dann würden wir ein Bild der Normalität erzeugen, das eine ganz andere, auch politische Botschaft aussendet.“ Dabei sei es wichtig, dass nicht nur Moderatorinnen und Moderatoren eine diverse Gesellschaft abbilden, sondern auch in Magazinbeiträgen, Dokumentationen oder Gesprächsrunden ganz selbstverständlich unterschiedlichste Menschen zu Wort kämen. So „zeigen wir Einwanderung oder Vielfalt nicht als ein problembehaftetes Thema, sondern dann ist das die Normalität in diesem Land“, so Krtalic. Einig sind sich die beiden Gesprächsteilnehmerinnen auch darüber, dass nur eine Vielfalt hinter den Kulissen – in Redaktion wie Produktion – auch gewährleistet, dass ein breites Themenspektrum abgedeckt wird. Uneins sind sie sich allerdings über den derzeitigen Stand der Veränderung, während Esra Karakaya die Umsetzung bislang nur in Einzelfällen beobachtet, sieht Iva Krtalic zwar eine langsame Entwicklung, aber durchaus einen merkbaren Wandel in den vergangenen Jahren.
Viel gelernt
Nach einem langen Tag mit vielen unterschiedlichen Gästen, klugen Gesprächen und wichtigen Themen, muss selbst Moderator Michel Abdollahi – der sich auch sonst intensiv mit dem Thema beschäftigt – bekennen: „Ich habe heute eine Menge gelernt, weil Menschen Dinge gesagt haben, die ich so noch nie gehört habe.“


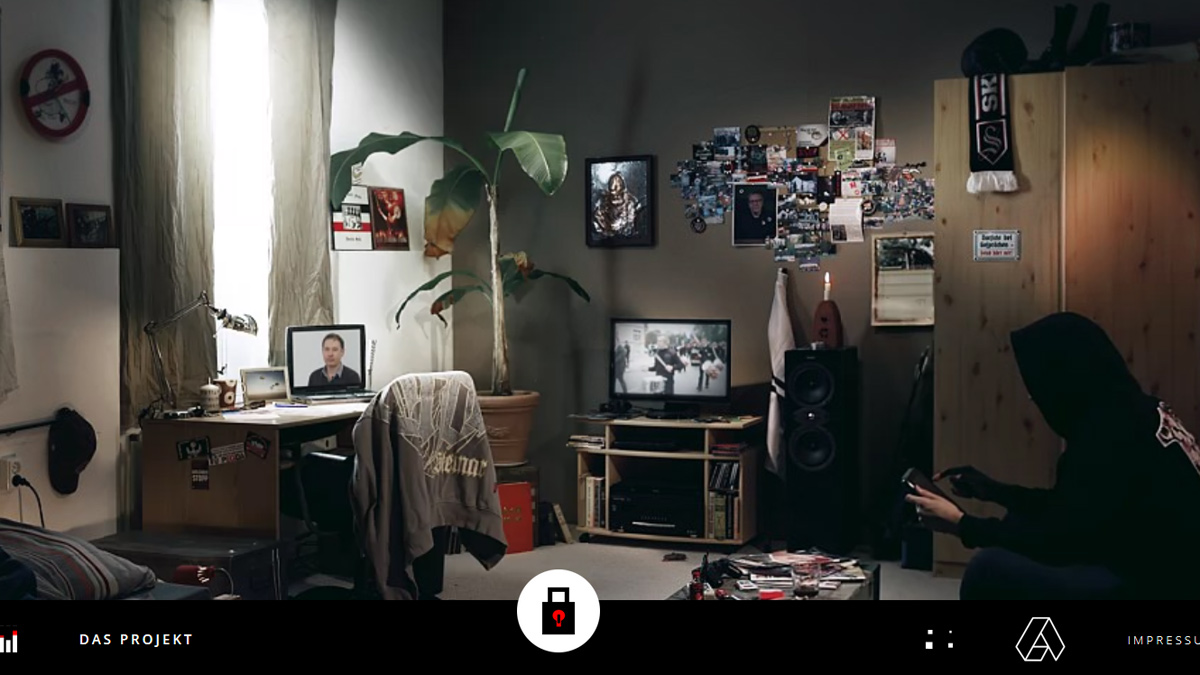







Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!