Mohamedou Slahi – „Riesen-Pechvogel oder ein genialer Terrorist?”

Wie kommt es dazu, dass der Sohn eines mauretanischen Kamelhirten nach einem erfolgreichen Ingenieurstudium in Deutschland ohne Anklage im Gefangenenlager Guantánamo festgehalten wird? Wieso wird er dort so heftig gefoltert wie kein anderer? Wie stehen seine Folterer heute dazu? In dem zwölfteiligen NDR Info-Podcast „Slahi – 14 Jahre Guantánamo“ werden unter anderem diese Fragen durch die intensiven Recherchen von Bastian Berbner und John Goetz beantwortet.
Die Zuhörer*innen begleiten die beiden Podcast-Hosts bei ihren Recherchen um die halbe Welt und können sich selbst ein Urteil über den Fall von Mohamedou Slahi bilden.
Der Podcast „Slahi – 14 Jahre Guantanamo“ ist für den Grimme Online Award 2022 in der Kategorie „Information“ nominiert. Im Interview berichtet Bastian Berbner über die Hintergründe des Podcasts, seine persönlichen Erfahrungen und Slahis Geschichte.
Wie kamen Sie auf die Idee, Ihre Recherchen über Slahis Geschichte nach der Veröffentlichung eines Dokumentarfilms noch zusätzlich in einem Podcast zu behandeln?
Das war gar nicht nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms, sondern weit vorher. Mein Kollege John Goetz hat jahrelang an dem Film und an den Recherchen gearbeitet, die später zu dem Film geführt haben. Irgendwann war klar, dass die Geschichte so vielfältig und nuanciert ist und so viele Seitentangenten besitzt, die auch interessant sein könnten, dass selbst ein 90-minütiger Dokumentarfilm nicht reicht, um diese Geschichte ganz zu erzählen. Dementsprechend war der Podcast dann das Medium der Wahl, weil das dort möglich ist. Wir haben uns auch im Podcast sehr fokussiert, aber am Ende haben wir uns zwölf Folgen Platz genommen, um die Geschichte umfassend zu erzählen. Dadurch konnte man manchmal durch eine Seitentür durchgehen und dort eine Weile verbleiben, was auch ein Vorteil des Mediums Podcast ist. Die Recherche ist im Investigativ-Team von John beim NDR entstanden und die hatten irgendwie das Gefühl, das sollte jetzt auch ein Podcast werden. Und so bin ich dann an Bord gekommen.
Ihre Recherche hat Sie auch nach Mauretanien geführt, Sie hatten zahlreiche Interviewpartner*innen in den USA – wie lange haben Sie und Ihre Mitstreiter*innen insgesamt an diesem Projekt gearbeitet?
Die Recherchen für den Film dauerten zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre an, aber am Podcast haben wir sehr intensiv ein Jahr lang gearbeitet. Wir haben mehrere Recherchereisen nach Mauretanien und in die USA gemacht und waren dort in acht Bundesstaaten, wenn ich das richtig gezählt habe. Es war schon sehr, sehr intensiv. Allein das Schreiben und Schneiden der einzelnen Folgen hat Monate gedauert.
Welche verschiedenen Rollen hatten die verschiedenen Teammitarbeiter*innen denn beispielsweise?
John, mein Co-Host, der seit vielen Jahren mit dieser Geschichte befasst war, hatte eine sehr enge Beziehung zu Mohamedou Slahi aufgebaut, um den es in dem Podcast und im Film ja geht. Er hat zum ersten Mal über Mohamedou berichtet, da war dieser noch in Guantánamo und ist dann sehr schnell, nachdem er freigelassen worden war, im Oktober 2016 nach Mauretanien gefahren und hat ihn besucht. John sagt, dass sich in dieser Zeit vorher schon fast so eine Art freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden aufgebaut habe. Man sieht das auch im Film, als John in Mauretanien am Flughafen ankommt und Mohamedou ihn begrüßt, umarmen sie sich, als ob sie Freunde seien, obwohl sie sich noch nie wirklich von Angesicht zu Angesicht gesehen hatten. Und das ist etwas, was einfach aus der jahrelangen Recherche heraus zwischen den beiden entstanden ist. Ich kam dann dazu mit einem frischeren, vielleicht auch etwas distanzierteren Blick auf Mohamedou. Als wir festgestellt haben, dass es diese zwei Rollen gibt – dass John emotional eher ein bisschen näher an ihm dran ist und ich etwas weiter weg –, haben wir uns entschieden, das im Podcast transparent zu machen. Das hat dann dazu geführt, dass wir immer wieder, auch on air, über Aspekte dieser Geschichte gestritten oder diskutiert haben. Mein Gefühl am Ende war, dass wir genau dadurch quasi Anwälte für die Hörer und Hörerinnen waren, dass man sich so wiederfinden konnte in diesem Zwiespalt zwischen „Ist er jetzt schuldig?“, „War er wirklich ein Terrorist?“ oder „Ist er komplett unschuldig?“. Irgendwo in diesem Graubereich dazwischen versuchten wir als Autoren uns zu verorten, und das haben wir im Gespräch miteinander ausgetragen. Das hilft vielleicht auch dem Publikum, dasselbe zu tun.
Sie haben unterschiedliche Personen für diese Geschichte interviewt, darunter auch Gefängniswärter, welche Slahi gefoltert haben. Wie schwer war es, diese Leute ausfindig zu machen?
Das hat John in jahrelanger Recherchearbeit mit großem Durchhaltevermögen und großer Kreativität geschafft, was alles andere als einfach war. Auch als ich dann dazukam, war noch nicht klar, wer alles sprechen würde und wer nicht. Später haben wir auch noch an viele Türen geklopft, die verschlossen blieben. Wir hatten wirklich das große Glück, mit den allermeisten Menschen sprechen zu können, die damals in Guantánamo mit Mohamedou direkt zu tun hatten, sprich: Wärter, Verhörer und auch den Chef des Folterteams. Warum die mit uns gesprochen haben? Sehr, sehr unterschiedlich. Eines der zwei häufigsten Motive war, dass die Menschen das Gefühl hatten, der Zeitgeist habe sich in eine andere Richtung entwickelt. Sie denken, dass sie damals richtig gehandelt haben, und fühlten sich verraten und betrogen. Sie wollten noch einmal sicherstellen, dass sie öffentlich klar sagen: „Das war richtig, gut und notwendig, was wir gemacht haben.“ Das andere Motiv war genau das Gegenteil, Scham und Schuldgefühl. Die Menschen hatten das Gefühl, dass sie einen riesigen Fehler begingen, indem sie bei dieser Foltermaschine in Guantánamo mitgemacht haben. Jetzt möchten sie gerne einmal öffentlich sagen, dass ihnen das bewusst ist und dass sie sich dafür schämen.
In einigen Folgen wird detaillierter über Slahis Folter gesprochen. Wie ging es Ihnen persönlich dabei, als Slahi darüber berichtete?
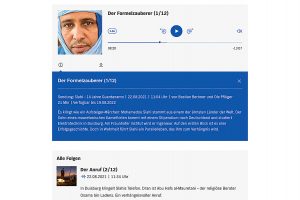
Das war natürlich nicht ganz einfach, weil wir da auch immer wieder drüber gesprochen haben. Mohamedou Slahi selbst ist jemand, der da relativ frei drüber spricht. Es ist nicht so, dass er einem das aufdrängt, aber wenn man danach fragt, ist er niemand, der zurückhält. Das ist als Journalist einerseits schwierig, wenn man sich diese Details anhören muss, andererseits natürlich auch wichtig, um die Geschichte zu verstehen. Die nachgelagerte Frage war für uns, wie viel wir davon eigentlich mit dem Publikum teilen. Da haben wir uns am Ende für eine sehr starke Reduktion entschieden. Es gibt Folgen, da geht es explizit um Folter, aber das ist schon eine enorme Reduktion dessen, was wir gehört haben und was auch tatsächlich stattgefunden hat. Wir haben versucht, das so zu reduzieren, dass man trotzdem einen Eindruck bekommt von dem, was passiert ist. Alles Wichtige ist drin und manchmal haben wir uns dafür entschieden, Dinge eher mit einem Label zu benennen, als sie wirklich genau zu erzählen, einfach, um nicht in so eine Art Folterporno reinzukommen. Das wollten wir auf gar keinen Fall und wir haben lange darüber nachgedacht, was die richtige Balance ist. Wie viel muss man sagen, um wirklich verstehen zu können, was vor Ort passiert ist mit Mohamedou? Und wie viel kann man weglassen?
In einer der Folgen berichten Sie von einer Auseinandersetzung mit einem von Slahis Folterern, als Sie ihn auf die Verwendung eines Lügendetektors und die Foltermethoden ansprachen. Beim Lügendetektortest wurde festgestellt, dass Slahi nach der Folterung in den Verhören nicht die Wahrheit gesagt hat, sondern viel mehr Geschichten erzählte, die zu dem passten, was die Verhörer*innen hören wollten. Der Chef des Folterteams behauptet, sich an die Durchführung eines solchen Lügendetektortests nicht erinnern zu können und reagierte auf die Anschuldigungen, verschiedene Foltermethoden zugelassen zu haben, ziemlich wütend und vorwurfsvoll. Haben Sie mit einer solchen Reaktion während den Interviews gerechnet?
Nein, habe ich tatsächlich nicht. Man muss sich vorstellen, dass das der Chef des Folterteams war, über dessen Schreibtisch damals alle wichtigen Dinge gingen, die mit Mohamedou Slahi zu tun hatten. Sowohl die Foltertechniken selbst als auch jede einzelne Methode, die von seinem Team angewandt wurde, mussten von ihm abgesegnet werden. Damals hieß es nicht Foltertechnik, sondern „Enhanced Interrogation Method“, das war der Euphemismus, der da benutzt wurde. Das heißt, das ist jemand, der qua Amt über das, was da passiert ist, sehr genau Bescheid wissen musste. Mohamedou Slahi war sein mit Abstand wichtigster Gefangener, auch der mit Abstand wichtigste Gefangene in ganz Guantánamo damals. Jetzt kann man davon ausgehen, dass der Chef dieser Einheit über die Geschehnisse des wichtigsten Gefangenen normalerweise sehr gut informiert ist. Diese Lügendetektortests, die mit Mohamedou gemacht wurden, waren in dieser Zeit, was die juristische Auseinandersetzung über ihn und seinen Fall anging, mit die wichtigsten Dinge, die überhaupt passiert sind. Deswegen bin ich als Autor in diesem Interview in Chicago mit Richard Sully, dem Chef des Folterteams, davon ausgegangen, dass er sich durchaus an diese wichtigen Momente erinnert. Als er dann im Interview behauptet hat, dass das nicht der Fall ist, und so tut, als ob das nicht stattgefunden hätte, war ich sehr verdutzt. Und je mehr ich insistiert, nachgebohrt und nachgefragt habe, ist eigentlich klar geworden, der will sich nicht erinnern und dem ist das jetzt unangenehm darüber zu reden. Diese Lügendetektortests haben im Prinzip den ganzen Fall für ihn zerstört und legen sehr deutlich offen, wie dilettantisch da von ihm und seinem Team gehandelt wurde. Ich glaube, das war ihm einfach in dieser Situation unangenehm, und das hat er versucht mit Wut, Empörung und Beschimpfungen zu überspielen. Das ist meine Theorie.
Haben Sie sich dadurch nicht eingeschüchtert gefühlt?
Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es hat nichts mit mir gemacht. Da sitzt dir einer gegenüber, schreit dich an und beschimpft dich und sagt, du seist unprofessionell und so weiter. Natürlich macht das was mit einem, aber man muss sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt des Interviews waren wir in der Recherche sehr tief drin. Wir hatten alle Berichte gelesen zu diesem Thema und wir hatten mit den allermeisten Menschen bereits im Detail gesprochen, daher wussten wir ziemlich genau, was damals passiert ist, wir kannten die Chronologie und so weiter. Und auf der Basis dieser Fakten bin ich ihm entgegengetreten und habe argumentiert und versucht herauszufinden, wie er mit diesen Dingen heute umgeht, die sowohl für uns als auch nach der völkerrechtlichen Definition ganz klar Folter sind – und auch von Teilen seines Teams als Folter anerkannt werden. Das Ziel dieses Interviews war herauszufinden, wie der Chef damit umgeht. Dadurch, dass er so zugemacht hat, wütend wurde, aus dem Interview rausgestürmt ist und uns mit wüsten Beschimpfungen im Hotelzimmer sitzen gelassen hat, ist das indirekt sehr gut gelungen. Dann war, glaube ich, ziemlich klar, wie er auf seine eigene Rolle und auf diese Zeit blickt.
„Riesen-Pechvogel oder ein genialer Terrorist” – mit welcher Annahme sind Sie in das Projekt gestartet und wie hat sich Ihre Position während der Recherchen und Aufnahmen verändert?
Das ist durchaus ein Fall gewesen, der bereits in der Öffentlichkeit verhandelt worden war. Es gab das Buch von Mohamedou, das ich mit als erstes gelesen habe, in dem er sich als völlig unschuldig beschreibt und verständnislos darüber, wie das passieren konnte. Das war der Startpunkt für mich. Ich hatte viele Artikel gelesen, die über ihn erschienen sind, die eine ähnliche Prämisse hatten. Es gab einen Hollywoodfilm, der damals noch nicht veröffentlicht, aber in der Mache war, eine Verfilmung seines Buches, der in dieselbe Richtung ging. Insofern ist dieses Narrativ vom „Riesen-Pechvogel“ von Anfang an in der öffentlichen Debatte sehr präsent gewesen, und ich kannte das natürlich. Wenn man sich mit den Details seines Falles beschäftigt und seine Akte liest, die damals das Bundeskriminalamt in Deutschland angefertigt hat – er lebte ja elf Jahre lang in Deutschland und war hier im Kontakt mit mehreren Islamisten und später auch Terroristen –, wenn man sich dann die Beschreibungen der Menschen anhört, mit denen wir in Amerika gesprochen haben, darunter Geheimdienstmitarbeiter und FBI-Agenten, dann kommt man natürlich schon ins Grübeln.
Wenn man das dann alles aufdröselt und so richtig in Mohamedous Vergangenheit reinbohrt, dann fängt man an, an diesem Unschuldsnarrativ zu zweifeln. Einfach weil da so viele Dinge sind, die „fishy“, also verdächtig, wirken. Er war zweimal in Afghanistan, hat dort Osama bin Laden die Treue geschworen und hat dort auch gekämpft. Er ist dann nach Deutschland zurückgekommen und ist mit vielen Menschen, die weiterhin in al-Qaida organisiert waren, in Kontakt geblieben. Einer seiner besten Freunde wurde zum Terroristen. Einer seiner weiteren besten Freunde hat versucht, einen Anschlag zu begehen, was ihm aber nicht gelungen ist. Noch kurz vor 9/11 war er in Kontakt mit Menschen in Afghanistan, die nah an Osama bin Laden dran waren. Er war in Kanada in einer Zeit, als ein großer Anschlag auf die USA vorbereitet wurde. Wenn man das alles auflistet, kommt man natürlich schon ins Grübeln. Kann das alles Zufall sein? So, und jetzt geht man zu Mohamedou nach Mauretanien und fragt ihn all diese Fragen. Wie kommt das, dass du da immer anwesend warst, bei all diesen Dingen? Und dann hat er für jedes einzelne eine Erklärung. Die ist manchmal überzeugender und manchmal weniger überzeugend.
So ging es für mich als Autor auch emotional zwischen diesen beiden Narrativen immer hin und her. Entweder der Riesen-Pechvogel, immer zum falschen Moment am falschen Ort, hat aber eigentlich nichts damit zu tun, was da passiert. Oder eben der Oberterrorist, der aus einem guten Grund zu diesen Zeiten an diesen Orten ist, es aber irgendwie schafft, seine Spuren so zu verwischen, dass er nicht ertappt wird. Ich habe mich da als Autor während der Recherche immer hin und her bewegt. Ich habe das im Podcast, glaube ich, nicht so klar ausgesprochen, aber am Ende bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es irgendwo zwischendrin liegt, aber wahrscheinlich eher Richtung Pechvogel als Richtung Oberterrorist.
Das Gefangenenlager Guantanamo steht schon seit einigen Jahren international in der Kritik. Halten Sie den Fall Slahi nach Ihren Recherchen für einen Einzelfall – oder denken Sie, dass in Guantánamo oder auch in anderen Gefängnissen noch mehr “Slahis” gefangen gehalten werden?

Das ist schwer zu beantworten. Es ist schon ein sehr einzigartiger Fall, einfach weil er die Vergangenheit hat, die er hatte. Wenn man sich mal die 800 Gefangenen in Guantanamo ansieht, mittlerweile sind es natürlich nur noch 40, aber 800 waren es mal, hat er schon eine sehr einzigartige Biographie. Nahezu niemand von denen, die in den ersten Jahren da hingekommen sind, war so nah mit Menschen verbunden, die so hoch in al-Qaida waren, wie Mohamedou. Die meisten waren irgendwelche Leute, die auf dem Schlachtfeld in Afghanistan aufgepickt wurden und eigentlich keine wirkliche Bedeutung für al-Qaida und Terroranschläge in den USA und im Westen hatten. Die sind in etwas reingeraten, was viel größer war als sie. Bei Mohamedou war das anders. Da gibt es schon noch ein paar andere Fälle von Häftlingen, bei denen es in die ähnliche Richtung ging, die allermeisten sind trotzdem freigekommen. Es gibt noch einen kleinen Kern von Gefangenen in Guantánamo, die immer noch da sind, bei denen auch die Schuld mehr oder weniger erwiesen ist und teilweise auch von ihnen zugegeben wurde. Das ist aber mittlerweile alles sehr öffentlich. Die amerikanischen Gefängnisse, also diese CIA-Geheimgefängnisse, in denen auch sehr stark gefoltert und gewaterboarded wurde, die gibt es, nach allem was wir wissen, nicht mehr. Aber ich kann natürlich jetzt keine allgemeine Aussage darüber treffen, was dort im Verborgenen vielleicht doch noch passiert oder nicht. Wir haben in der Vergangenheit gelernt, dass Dinge möglich sind, die wir nicht für möglich gehalten haben, auch in den USA. Insofern, nach allem was ich weiß, ist Mohamedou Slahi ein ziemlich einzigartiger Fall. Aber natürlich kann ich das nicht definitiv sagen.
Welches Feedback haben Sie zum Podcast bekommen?
Es war überwältigend. Wir haben ganz viele Zuschriften in unterschiedlichste Richtungen von Hörern und Hörerinnen bekommen. Eine Konstante war, und das hat mich als Autor sehr gefreut, dass sich eigentlich jeder beim Hören zwischen diesen extremen Polen hin- und hergerissen fühlte. Dieses ständige sich selbst Verorten, wie steht man zum Protagonisten dieser Geschichte? Das hat, glaube ich, auch beim Publikum sehr gut funktioniert. Das ist etwas, was mir als Autor sehr wichtig ist, dass ich nicht von vornherein sage: „Okay, nach einem Jahr Recherche bin ich zu folgender Meinung oder Haltung gekommen, die teile ich jetzt mit euch“, sondern dass ich stattdessen diesen Prozess nacherzähle und dementsprechend fürs Publikum transparent mache, was auch bei mir als Autor passiert ist. Dass das gut funktioniert hat, ist in der Rückmeldung immer wieder gekommen. Auch, dass man emotional in diese Zeit und an diesen Ort mitgenommen wurde, der ja so geheimnisumwoben ist wie wenige andere, dass wir da Einblick in dieses Milieu schaffen konnten, das fand ich toll. Das lag, glaube ich, einfach daran, dass wir das Medium Podcast gewählt haben. Dadurch, dass man so nah rankommt und die Originalstimmen der Menschen hört. Wir haben auch versucht, so viel wie möglich vom englischen Originalton stehen zu lassen und nicht mit Übersetzungen oder dergleichen drüber zu sprechen. Wir hatten das Gefühl, das ist so gut und so nah, wenn man den Menschen selbst zuhören kann, wie sie über diese wichtigen Momente ihres Lebens sprechen. Und da liegt für mich eine der größten Chancen dieses Mediums, dass man an die Gefühlswelten von Menschen viel unmittelbarer rankommt, als es durch mich als Autor möglich wäre. Ich bin ja eigentlich Print-Journalist und ich kann mich noch so sehr bemühen, in einem Artikel etwas zu beschreiben, was oder wie jemand etwas gesagt hat. Das wird nie so deutlich rüberkommen, als wenn man diesen Menschen einfach selbst zuhört, mit ihrer eigenen Stimme, Wortwahl und der Intonation, die sie benutzen. Und das ist, glaube ich, hier ganz gut gelungen, weil wir das Glück hatten, dass diese Menschen, die wir vors Mikrofon bekommen haben, eben so offen und authentisch gesprochen haben.
Das Interview führten Jasmin Erraji und Sigrid Koch. Die Interviews entstanden in medienpraktischen Übungen im Bachelor-Studiengang “Mehrsprachige Kommunikation” an der TH Köln.




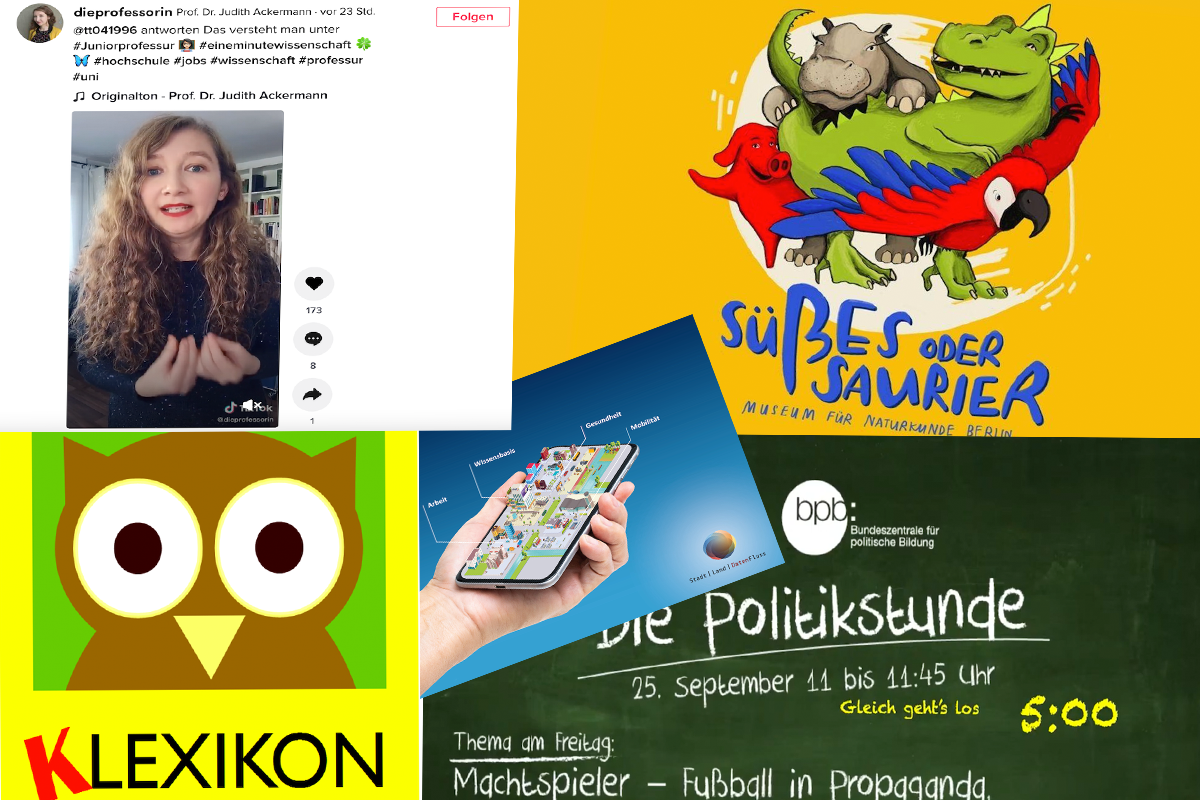

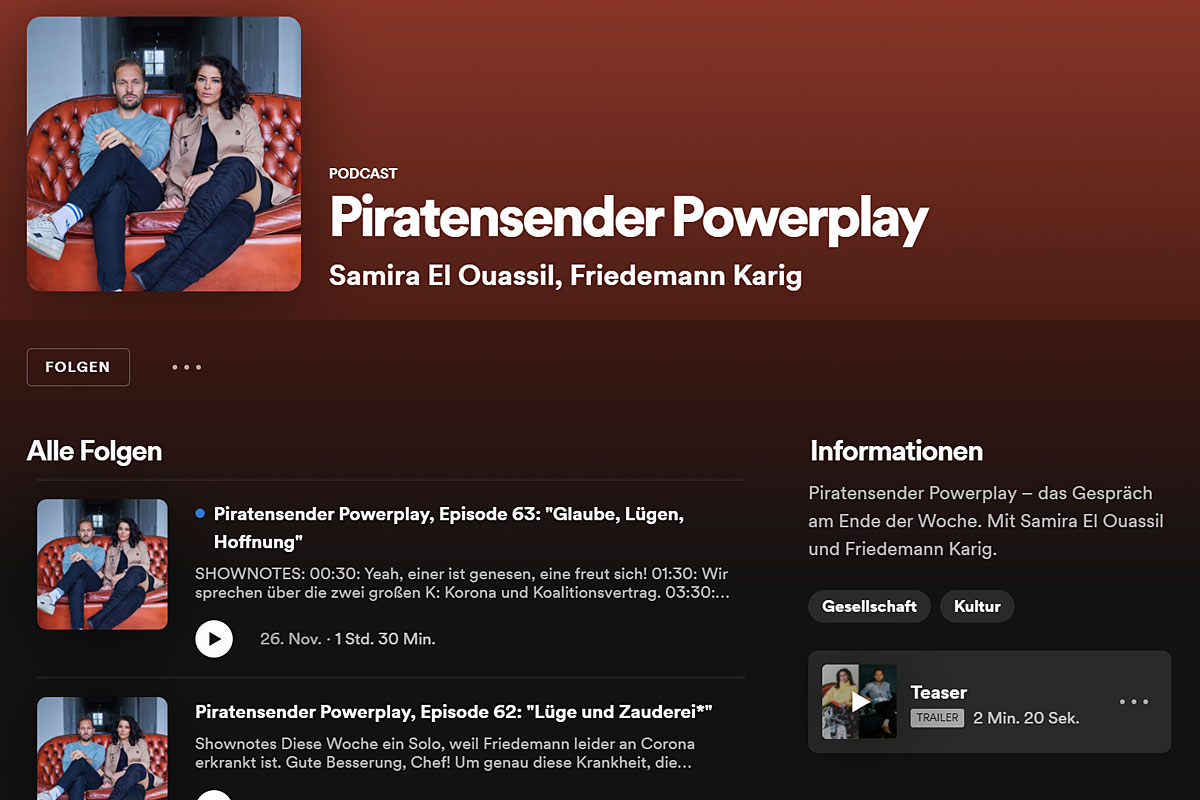

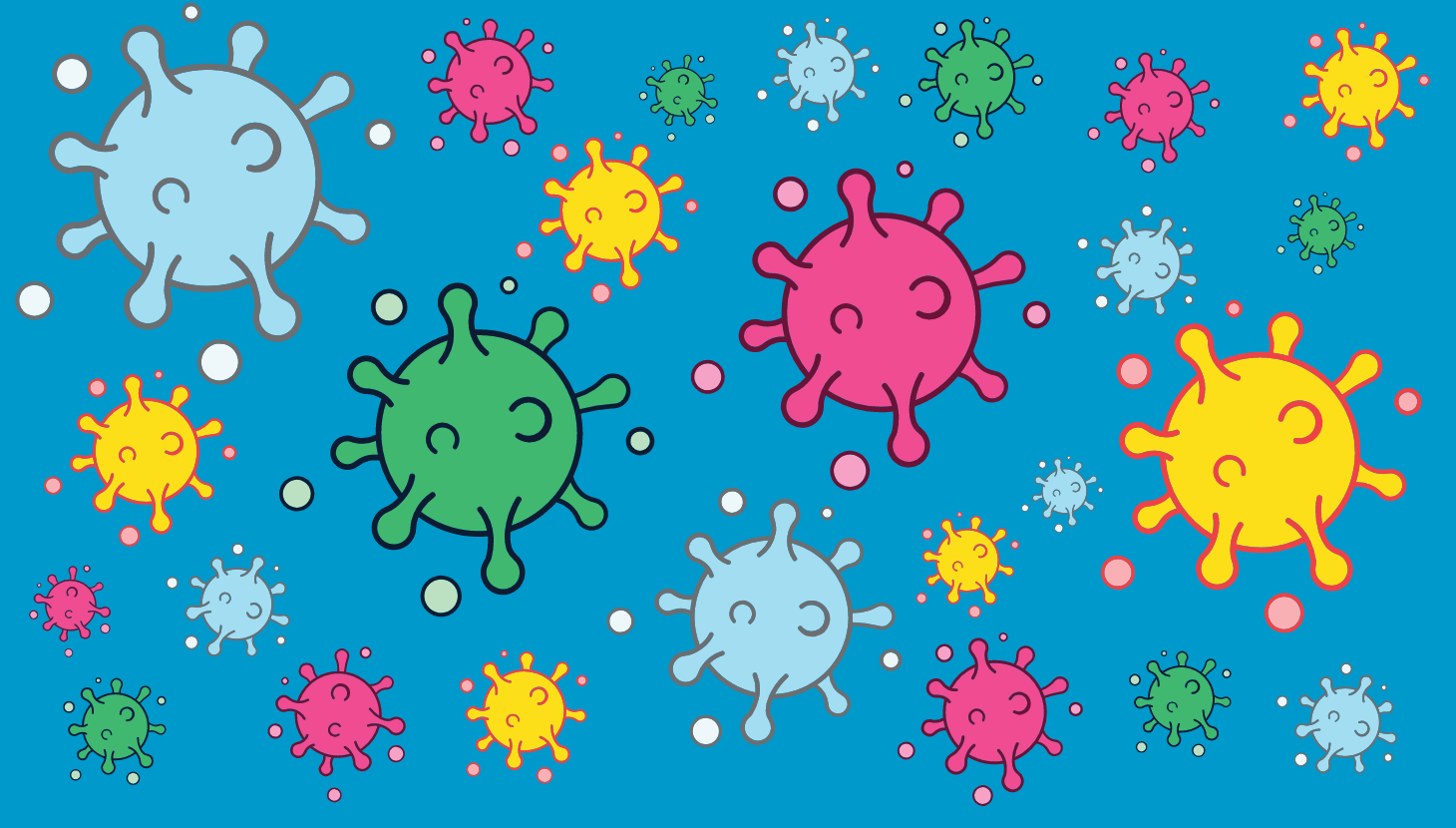



Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!