„Ist das eigentlich noch Fernsehen?“

Mit dem Ruf nach einer Verfassungsklage beginnt am 19. März die Veranstaltung zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Freunde des Adolf-Grimme-Preises, dem unterstützenden Verein des Fernsehpreises des Grimme-Instituts. „Ich habe das von meinen Gebühren gezahlt“, beschwert sich Jürgen Büssow, der Vorsitzende des Freundeskreises, warum also sollten die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Sendungsbeiträge nur sieben Tage ins Netz stellen dürfen? Damit umreißt er knapp das Thema des Workshops, der mit „Wie sehen die künftigen Rahmenbedingungen für die Sicherung von Qualitätsfilm und Leitmedien aus?“ überschrieben ist. Er soll eine Standortbestimmung des Fernsehens gegenüber den digitalen Medien geben und ist prominent besetzt, unter anderem mit SWR-Intendant Peter Boudgoust, Kay Oberbeck, dem Kommunikationschef von Google Deutschland, Helmut Thoma, dem ehemaligen Geschäftsführer von RTL, NRW-Medienstaatssekretär Marc Jan Eumann und dem Netzjournalisten und Fernsehmoderator Jörg Schieb.
Qualitätsbewusstsein schärfen
Dass die Digitalisierung das Mediennutzungsverhalten gravierend beeinflusst und damit auch erhebliche Rückwirkungen auf die Medienanbieter hat, stellt die Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien, Angelica Schwall-Düren, in ihrem Grußwort fest. Die Entwicklungen haben mit der Schließung der Redaktionen der „Westfälischen Rundschau“ auch NRW dramatisch erschüttert, deshalb sei es „unverzichtbar, dass wir uns die Frage stellen, wie Vielfalt und Qualität der Medien gesichert werden können.“ Die Landesregierung habe sich mit der „Stiftung Partizipation und Vielfalt“ vorgenommen, den Lokaljournalismus im Land zu fördern. Die zentralen Mittel seien eine Stiftungsprofessur für Lokaljournalismus und Recherchestipendien. Dabei soll die Stiftung, die 2014 ihre Arbeit aufnehmen soll, unbedingt staatsfern und nicht wettbewerbsverzerrend sein.
Nicht nur der Printjournalismus, sondern auch der Rundfunk sei von der Digitalisierung betroffen, so Angelica Schwall-Düren. Vorwiegend jüngere Nutzer hätten sich längst vom Fernsehgerät verabschiedet und sähen ihre Fernsehsendungen im Netz. Die Änderung des Rundfunkbeitrags war Reaktion darauf, allerdings habe sie auch die Erwartungshaltung an die öffentlich-rechtlichen Sender aufgezeigt. Und da schlägt die Ministerin den Bogen zum Grimme-Preis, der sich seit fast 50 Jahren der Qualitätsbeurteilung widmet. Er zeige, dass Qualitätsstandards nicht gleichbleibend seien, sondern auch immer eine Momentaufnahme, die mit dem Zeitgeist verbunden seien. Das Ziel müsse aber sein, dass jeder Mediennutzer sein eigenes Qualitätsbewusstsein schärft.
Gegen Billig-Journalismus im Netz
Auftragsgemäß macht der Intendant des SWR, Peter Boudgoust, kaum eine Bedrohung des Fernsehens aus: Mehr als drei Stunden schauten die Deutschen im Schnitt täglich fern, das Fernsehen, insbesondere ARD und ZDF als beliebteste Programme, spiele nach wie vor eine große Rolle in Deutschland und hätten eine wichtige Funktion bei der Meinungsbildung. Fernsehen sei auch und gerade in Zeiten des Web 2.0 notwendig, denn „bei Facebook empfehlen nur Freunde, die die gleichen Interessen haben, wie ich. Und wenn dann noch ein Algorithmus errechnet, was mir gefallen könnte, bewege ich mich auf eingefahrenen Bahnen.“ Wenn man nur die Informationen aus der eigenen sozialen Blase wahrnehme, gefährde dies auch die Gesellschaft.
Die riesige Nachrichtenmenge, die das Web bereithielte, überfordere zudem viele Nutzer. Hier seien die Journalisten gefordert, sie müssten einordnen, auch prüfen, ob Meldungen wahr seien oder nicht. „Echter Journalismus ist in unserer Gesellschaft unverzichtbar, das bezieht auch die Presse ein.“ Mit den Printmedien würde Boudgoust gerne intensiver zusammenarbeiten, statt sich zu bekämpfen, sich gemeinsam wehren gegen nicht verifizierbare Nachrichten, gegen Billig-Journalismus im Netz und Allianzen schmieden zugunsten des Qualitätsjournalismus von morgen.
Auch ein verändertes Medienverhalten lasse die Menschen nicht auf Qualitätsnachrichten verzichten, dies zeige auch der Erfolg der Tagesschau-App, wirbt Boudgoust für die eigenen Angebote. „Wir müssen auf die veränderten Nutzungsgewohnheiten der Menschen reagieren und das Programm dort anbieten, wo die Zuschauer es möchten.“ So sei der Second Screen, der zweite Bildschirm, eine unaufhaltsame Entwicklung. Der Zuschauer wolle mitmachen und mitreden, noch während das Programm läuft. „Interaktives Fernsehen, Social TV, die Konvergenz ist nicht die Zukunft, sondern das ist jetzt“, stellt Boudgoust fest, „die Möglichkeiten sind aber noch nicht ausgeschöpft.“
Diese Möglichkeiten möchte er insbesondere mit Blick auf die jüngere Generation ausschöpfen, „denn die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben ein Nachwuchsproblem, wir bieten den jüngeren Zuschauern zu wenig.“ Ein Teil von ihnen fühle sich bei den Privaten besser abgeholt, obwohl dort die Qualität nicht stimme. Eigentlich aber wollen sie Qualitätsangebote nutzen – und mit genau diesen müssten die Öffentlich-Rechtlichen überzeugen.
Ergänzen ja, ersetzen nein
Der technischen Komponente der Medienwandels von Radio und Fernsehen zum Internet widmet sich Olaf Korte vom Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Zunächst aber zählt er die Vorteile des Radios auf: Es sei ein so erfolgreiches Medium, weil man es passiv und in jeder Situation nutzen könne, man müsse nicht mal die Energie aufbringen, Inhalte auszuwählen. Außerdem sei es eine preiswerte Technologie um die Fläche abzudecken und es sei vor allem nicht anfällig – beim Hurrikan Katrina war es das letzte Medium, das noch funktionierte.
Doch das Radio sei bedroht, erklärt Korte, „die Werbeeinnahmen sinken und die analoge Verbreitung ist an seiner Grenze angekommen“, die Kanäle können nicht mehr gespalten werden, so dass keine zusätzlichen Sender mehr senden können. Die digitale Verbreitung schaffe da Abhilfe, allerdings gebe es dann auch mehr Konkurrenz, was die Werbeeinnahmen weiter schmälere. Das Internetradio hingegen sei eher für Sparten und kleinere Nutzergruppen geeignet. Diese Entwicklung sei beim Fernsehen ähnlich. Bessere Individualangebote im Netz wirkten sich auf die Fernsehnutzung aus. Doch: „Digitale Zusatzangebote werden die klassischen Medien ergänzen, aber nicht ersetzen“, erklärt Korte.
Auch unter dieser Prämisse würden die Datenvolumina und damit die Anforderungen an die Netzqualität um ein Vielfaches steigen. „Bandbreite wird eine kostbare Ware bleiben, deshalb müssen wir genau überlegen, wofür wir die Bandbreite nutzen“, so Korte, „da kommt man schnell an die Frage der Netzneutralität.“ Eine flexiblere Zuteilung von Frequenzen könne eine Lösung sein, so könnten brachliegende Frequenzbereiche temporär belegt werden. „Die Zukunft liegt ganz klar in hybriden Netzen“, schlussfolgert Korte.
Diese Entwicklung hat nicht nur Auswirkungen auf die Netze, sondern sichtbar für jeden Einzelnen auch auf die Geräte und die Plattformen: „Wir brauchen in Zukunft Geräte, die wir überall nutzen können. Deshalb brauchen wir auch flexible Plattformen.“ Neue Betriebssysteme wie Android oder iOS seien wesentlich einfacher zu bedienen als die althergebrachten PC-Systeme. „Ich gehe davon aus, dass wir in ein paar Jahren in privaten Haushalten keine PCs mehr haben, und um die Datensicherung brauche ich mich auch nicht mehr zu kümmern, denn die Daten sind in der Cloud – ob das nun gut ist, oder nicht“, prognostiziert Korte. Alle Geräte könnten eigentlich alles, aber sie hätten Schwerpunkte in der Anwendung – ein Tablet sei sehr gut für unterwegs geeignet, einen Fernsehfilm in HD würde man darauf allerdings eher nicht ansehen.
Gratis ist nicht böse
Claudia Loebbecke, Wirtschaftswissenschaftlerin von der Universität zu Köln, bekennt gleich zu Beginn ihres Vortrages, dass das Finanzierungsmodell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Betriebswirtschaft nicht gut zu fassen ist. Deshalb konzentriert sie sich auf die direkte Finanzierung und die indirekte Finanzierung über Werbung. Prämisse ihrer Theorie ist, dass die Herkunft der Inhalte im Internet nicht mehr nachvollziehbar ist. „Wenn der Inhalt im Internet ist, habe ich dann ferngesehen, habe ich Zeitung gelesen?“, fragt Loebbecke. Eigentlich aber sei das dem Konsumenten, den sie „Tante Lenchen“ nennt, egal. Es gelte schlichtweg, Tante Lenchen – und damit uns alle – für jedes einzelne Angebot zu begeistern.
Grundsätzlich könnten Medienkonsumenten entscheiden, wann sie Massenprodukte konsumieren und wann sie qualitativ hochwertige Medien nutzen. „Wir sind alle genug gebildet, unsere Wahl zu treffen“, bezieht sie auch die Zuhörer ein. Damit bliebe eine Regulierung über Angebot und Nachfrage: Die digitalen Medien schüfen eine größere Zahl von Angeboten aus dem der Konsument ein Angebot auswähle, das ihm gefalle und zu einem Preis, der für ihn akzeptabel ist, verfügbar sei. „Wir mögen doch alle gratis“, plädiert Loebbecke, „das ist nicht die böse Gratismentalität, sondern das Internet macht es endlich möglich, auch mal etwas gratis zu bekommen. Wer die Auswahl hat – wen soll man da verurteilen, der etwas gratis nimmt.“
Also müssten die Medien wieder dahin kommen, dass die Konsumenten für Medienangebote zahlten, wie es in den klassischen Printmedien ist. Dies könne nur funktionieren, indem man die Menschen, insbesondere die Nachwachsenden, wieder für Themen begeistere: „Wenn man sich für ein Thema interessiert, will man auch alles dazu lesen“ – und ist bereit, dafür zu bezahlen.
Die Finanzierung über Werbung sei für die digitalen Medien keine umfassende Lösung, denn sie beruhe auf dem Konzept der Massenmedien. „Werbung braucht die Masse, nicht die Personalisierung“, erläutert Loebbecke. „Im Internet ist der große Heilsbringer der Werbung nicht mehr der Tausend-Kontakt-Preis, sondern die Messbarkeit.“ Jeder Klick werde gemessen – und auch nur der gezahlt. Zudem sei das Risiko relativ groß, dass die Werbung ausgeblendet werde. „Wir sollten uns also auf eine Medienlandschaft vorbereiten, in der Werbung und Werbeeinnahmen stark zurückgehen“, schlussfolgert Loebbecke.
Paid-Content ist es nicht
Diese Einschätzung von Claudia Loebbecke wird der Unternehmenssprecher von Google Deutschland, Kay Oberbeck, wohl nicht teilen. In anderen Punkten stimmt er aber mit ihr überein. Oberbeck bekräftigt, dass die Bezugsgröße im Internet immer mehr nur der einzelne Artikel sei. Die Nutzer gingen nicht mehr über die Homepage, aber auch nicht mehr nur über die Suchmaschine, sondern es gebe zahlreiche Wege, unter anderem über soziale Netzwerke, wie einzelne Seiten erreicht würden. Damit würden es auch Portale zukünftig schwer haben, es sei für die Anbieter vielleicht cleverer, sich eine thematische Nische zu suchen.
„Man muss versuchen, die Nutzer, die zufällig auf einem Angebot landen, zu einem regelmäßigen Nutzer machen“, fordert Oberbeck, der Relaunch der Homepage hingegen, auf den so viele Anbieter setzten, sei nicht mehr wichtig. Viele Amerikaner wendeten sich von Nachrichtenmedien ab, weil sie nicht passend informiert würden, erzählt Oberbeck, und sieht diese Gefahr durchaus auch für Deutschland. Dabei sei es im Internet doch möglich, sehr genau herauszufinden, was die Leser mögen und was sie nicht mögen. Journalisten sollten aber all die Möglichkeiten, die sich böten, nutzen und sich über alle Facetten des Journalismus Gedanken machen – was nicht hieße, dass man alles über den Haufen werfen müsse. Die Architektur von Nachrichtenmedien habe sich in den letzten Jahren kaum geändert, sie folge einem Vorgängermedium. „Warum denkt man das nicht neu? Können wir nicht aus Archivinhalten mehr rausholen? Digital first? Wie entwickelt sich der Artikel in einem Medium, das viel mehr von Kommentaren lebt?“, wirft Oberbeck Fragen in den Raum.
Mit den digitalen Medien gebe es eine Vielfalt an veröffentlichten Inhalten, wie nie zuvor. „Sicher sind nicht alle bei YouTube hochgeladenen Inhalte qualitativ hochwertige Inhalte“, gibt Oberbeck zu, „aber es gibt objektiv mehr hochwertige Inhalte – es ist nur eine Herausforderung, sie zu finden.“ Natürlich ist es auch eine Herausforderung, sie zu finanzieren. Die Antwort sieht er – naturgemäß – nicht in Paid-Content-Modellen, obwohl die „New York Times“ ein Angebot mit vielen Einstellungsmöglichkeiten für den Nutzer anböte, das jetzt von der „Welt“ adaptiert worden sei.
Die Zeitung als Auto
Nach einer Pause spricht mit Christian Nienhaus von der WAZ Mediengruppe nicht nur der Gegenpol zu Google, sondern derzeit auch ein direkter Gegner, nicht nur im Streit um das Leistungsschutzrecht, sondern auch um Werbeeinnahmen. Mit seiner Eröffnung möchte er den Zuhörern „die Illusion rauben, dass das gedruckte Medium am Ende seiner Schaffenskraft ist.“ Er beschreibt die Zeitung als digitales Medium, weil der Produktionsweg voll digital ist.
Im Folgenden entwirft er die Idee, dass Zeitung und digitale Medien auch in Zukunft nebeneinander existieren können, wie auch Flugzeug und Auto nebeneinander überleben können und ruft nach einer gesetzlichen Regelung bezüglich öffentlich-rechtlicher Internetangebote wie der Tagesschau-App. Darüber hinausgehende öffentliche Unterstützung lehnt Nienhaus aber ab: „Zeitungen sollten privatwirtschaftlich organisiert bleiben. Sie haben einen großen Anteil auch an Enthüllungen politischer Zusammenhänge gehabt, deshalb sollten sie staatsfern bleiben.“
Andererseits antwortet er auf den Vorwurf, dass die Schließung einer Lokalredaktion die Vielfalt gefährde, damit, dass sich die Medienlandschaft stark verändert habe und im Internet eine Gegenöffentlichkeit vorhanden sei. Mit den Produktionsbedingungen dort ist Nienhaus aber trotzdem nicht einverstanden: „Blogger sind selbständig und frei, aber auch selbstausbeuterisch tätig, während die Zeitungsverlage ihre Journalisten nach Tarifvertrag bezahlen.“ Grundsätzlich sieht er das jahrhundertealte Geschäftsprinzip von Zeitungen durch das Internet ausgehebelt: „Wer etwas lesen möchte, muss uns Geld bezahlen. Im Internet gibt es die Informationen umsonst, und man versucht jetzt mühselig, Erlösmodelle zu schaffen.“
Fußball und die Reichweite
Der immer unterhaltsame ehemalige Geschäftsführer von RTL, Helmut Thoma, behandelt in seinem polemischen Vortrag sein Lieblingsthema – private gegen öffentlich-rechtliche Fernsehanbieter. Im Zuge dessen vergleicht er das deutsche Mediensystem mit italienischen Verhältnissen, beschimpft die Öffentlich-Rechtlichen als Opa-Sender und rechnet die Reichweiten nach Inhalten neu: „Fußballer spielen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in etwa genauso wie bei den Privaten, das ist keine originär öffentlich-rechtliche Qualität – also muss man es aus der Reichweite rausrechnen.“ Thomas Schlussfolgerung lässt sich in seinen Eröffnungssätzen zusammenfassen: „Was jetzt rausgekommen ist, ist erschreckend. Das berühmte Duale System besteht de Facto nicht mehr.“ Zum eigentlichen Thema des Tages trägt Helmut Thoma nur die Prognose bei, dass Google in den Einnahmen die Printmedien in den USA bereits jetzt übertrifft und dies in Deutschland auch so kommen werde.
Keine neuen Medien
Die schwierige Aufgabe, nach Helmut Thoma zu sprechen, übernimmt Gerhard Schmidt aus dem Vorstand der film&fernsehproduzenten NRW. Nach der Eröffnungsfrage, wie Film- und Fernsehproduzenten auf die neuen Medien vorbereitet seien, behandelt er hauptsächlich die Konzentration im Markt der Produktionsfirmen und deren Finanzierung aus den Töpfen der öffentlich-rechtlichen Sender sowie die Bemühungen der privaten Sender, ein möglichst billiges Programm zu produzieren. Ob das Schnarchen aus der letzten Reihe von seinen Ausführungen hervorgerufen wurde, oder die Erholung vom Thoma-Donnerwetter ist, vermag an dieser Stelle nicht beantwortet zu werden.
Hauptsache, die Inhalte werden gesehen
Nach seinen Vorrednern glaubt der Journalist Jörg Schieb fast, sich dafür schämen zu müssen, dass er für öffentlich-rechtliche Sender arbeitet. „Tu ich aber nicht“, entgegnet er, „weil wir nicht nur unterhalten, sondern auch informieren.“ Mit Begeisterung berichtet er von seiner Rubrik „Angeklickt“ in der „Aktuellen Stunde“ des WDR: „Sie ist Medienkompetenzerzeugung im besten Sinne. Die Leute lernen, wie sie sich im Internet bewegen.“
Die Frage, wie sich Fernsehen heute verändern müsse, beantwortet er damit, dass die Möglichkeiten des Internet genutzt werden müssen: Podcasts, Foren oder Soziale Netzwerke. „Damit können die Zuschauer intensiv in die Themenfindung und in die Sendung eingebunden werden“, erklärt er das von „Angeklickt“ und dem „Ratgeber Internet“ schon lange verfolgte Konzept. Dann müsse man allerdings auch versuchen, die erzeugten Programminhalte in das Internet zu transportieren. „Was wäre schöner, als die Programminhalte abrufbar zu haben?“, verweist er auf die „7-Tage-Regelung“ und erklärt, dass dies keine Idee der öffentlich-rechtlichen Anbieter war, sondern eine gesetzliche Regelung, die aus einem Kompromiss entstanden sei. Dies würde allerdings in der Öffentlichkeit nicht immer korrekt dargestellt. „Wo die Inhalte geguckt werden, ist mir letztlich egal“, bekräftigt Schieb den Wunsch nach einer stärkeren Nutzung der digitalen Medien auch von öffentlich-rechtlichen Sendern, “ durch ein Einstellen von Inhalten in Mediatheken und einen YouTube-Kanal würde auch das Wahrnehmungsproblem bei den jüngeren Nutzern verringert werden.“
Über Mediengrenzen hinweg
Jan Metzger, der Intendant des kleinsten ARD-Senders Radio Bremen, kann dem Kurzvortrag von Jörg Schieb in allen Punkten nur zustimmen – was ihn nicht davon abhält, noch einen eigenen Vortrag zu halten. „Ich glaube dass wir – immer mit Absenderkennung versehen – auf allen Kanälen vertreten sein müssen, dort wo die Leute sind“, schließt er sich der Forderung nach mehr – erlaubter – Präsenz im Netz an.
Die Änderung der Arbeitsweise der öffentlich-rechtlichen Sender an „drei fundamentalen Stellen“ schließt auch interne Strukturen ein: Metzger erläutert, dass auf die drei Säulen Fernsehen, Radio und Internet verzichtet werden und stattdessen direkt zusammengearbeitet werden müsse, was seinen Ausführungen nach, einer Kulturrevolution gleichkommt. Des Weiteren müsse sich eine zukünftige Programmstrategie nicht nach Sendeplätzen, sondern nach Inhalten richten. „Man kann keinen wertvollen Inhalt auf nur einer Plattform anbieten. Der Lebenszyklus eines Themas muss geplant werden, alles andere ist eine Verschwendung von guten Geschichten“, appelliert er an das Denken über Mediengrenzen hinweg. Zudem müsse alles was gesendet würde um den Dialog ergänzt werden. Das Internet sei nicht nur ein neuer Vertriebsweg, sondern eine neue Möglichkeit zum Kontakt mit dem Publikum, zum Dialog auf Augenhöhe. Außerdem könnte das Publikum gerade über die digitalen Medien auch als Quelle dienen.
„Letztlich geht es aber um die Qualität unserer Programme“, schlussfolgert Metzger. „Es muss glaubwürdig und verlässlich sein, unterscheidbar von anderen, nur dann wird uns die Allgemeinheit finanzieren. Relevanz ist hierfür die Voraussetzung – und sie kommt aus Qualität und aus Reichweite.“
„Was sind uns Medien wert?“
Der Direktor des Grimme-Instituts, Uwe Kammann, der für den wegen starken Schneefalls verhinderten Jakob Augstein einspringt, blickt als Beobachter auf das Internet. „Wie finde ich die Zugänge in einem Medium, das als Metamedium fungiert?“, fragt er zu Beginn. Auch er konstatiert einen neuen Reichtum, der als Gegenteil aber die Möglichkeit der Orientierungslosigkeit in sich trage. Die Vielfalt sei garantiert, das weltweite Gesamtangebot verhindere, dass Informationen unterdrückt würden, lediglich die Auffindbarkeit sei das Problem.
Dann widmet er sich der Kernkompetenz des Grimme-Preises, der Qualität. Hierzu stellt Kammann fest, dass es insgesamt eine hohe Qualität in den Medien gebe, da heute alles stärker professionalisiert sei. Qualität sei aber auch bedingt durch die Nachfrage, die nicht in allen Bereichen gleich hoch sei, deshalb müsse sie öffentlich gefördert werden. Insofern sei der Rundfunkbeitrag auch eine Demokratieabgabe für einen Diskurs, an dem zwar nicht alle teilnähmen, für den die Grundlage aber als Angebot vorhanden sein müsse. „Es ist die Frage: Was sind uns Medien wert?“, fasst Kammann zusammen.
Panel mit Timeout

v.l.: Jürgen Büssow; Vorsitzender der Freunde des Adolf-Grimme-Preises; Marc Jan Eumann, Medienstaatssekretär NRW; Christian Nienhaus; WAZ Geschäftsführung; Jan Metzger, Intendant Radio Bremen (Foto: Ulrich Spies)
Abschließend bringt Moderator Jürgen Büssow die meisten der bisherigen Sprecher zusammen und bittet den Medienstaatssekretär Marc Jan Eumann in die Runde. Zunächst spricht aber noch einmal der Intendant von Radio Bremen, Jan Metzger. Er zahle für drei Zeitungen, die er elektronisch lese. „Es ist nicht die Frage, auf welchem Weg, sondern eine Frage der Qualität“, erklärt er. Zeitungen würden andere Informationen, zum Beispiel im Lokalen, bieten, als Rundfunksender. „Warum werden nicht Fernsehformate der öffentlich-rechtlichen Sender übernommen?“, appelliert er an die Zeitungsverleger.
In der Folge entwickelt sich eine privat geführte Debatte zwischen Jan Metzger und Christian Nienhaus von der WAZ, an der sie die Zuhörer leider nicht teilhaben lassen. Nicht einmal Marc Jan Eumann, der neben ihnen stehend die „neuen Medien“ in Form eines Smartphones ganz praktisch erprobt. Er blickt auf, als Helmut Thoma die Runde vorzeitig verlässt. „Ich wollte Ihnen noch sagen, dass ich mit fast allem, was Sie gesagt haben, nicht übereinstimme“, ruft Eumann Thoma hinterher. Nach einem abschätzigen Blick kommt Thomas viel- und nichtssagende Antwort kurz bevor sich die Tür hinter ihm schließt: „Das hab ich mir bei Ihnen gedacht.“
Kay Oberbeck spricht sich nach der insgesamt dominierenden Fürsprache für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch einmal für die Werbung aus. „Man kann Werbung optimieren, indem man die vermittelt, die passt“, erläutert er das Google-Konzept. Dem Leistungsschutzrecht hingegen steht er skeptisch gegenüber: „Es wurde im Wahljahr noch kurz durchgesetzt, mal sehen, was es bringt“, spricht er Christian Nienhaus direkt an.
Abschließend darf der bestens gelaunte Medienstaatsekretär den politischen Standpunkt der NRW-Landesregierung erläutern, natürlich mit Blick auch auf die Bundespolitik. Zunächst geht Marc Jan Eumann aber noch einmal auf den Vortrag von Helmut Thoma ein. Als „katastrophale Fehleinschätzung“ bezeichnet er Thomas Beurteilung, in Deutschland herrschten italienische Verhältnisse. Auch auf Kay Oberbeck geht er direkt ein, er verlangt eine „Algorithmenethik“. „Mein Algorithmus ist der Kern meines Geschäftes, in den darf niemand reinschauen – das geht so nicht“, erläutert er diesen Begriff. Ein Algorithmus fände das besonders leicht, was bereits besteht oder Konsens ist – eine Gegenmeinung hingegen hat es schwer. Als Beispiel führt er zwar den amerikanischen Präsidenten Obama an, der im Internet leichter gefunden würde, als seine Wahlkampfgegner, dies lässt sich vom Zuhörer aber nur zu leicht auf den Wahlkampf in Deutschland übertragen. Zum Schluss kündigt Eumann noch an, dass die Landesregierung ab heute (25. März) den Arbeitsentwurf zum Landesmediengesetz ins Netz stellen wird und jeder Nutzer dazu äußern kann.
Marc Jan Eumann setzt auch den Schlusspunkt unter die Veranstaltung: Als Moderator Jürgen Büssow aus nicht unbedingt nachvollziehbaren Gründen beginnt, über Solarenergie zu sprechen, macht er das unmissverständliche und aus dem Sport bekannte Handzeichen für einen Timeout und bittet so zum anschließenden Get-Together bei Altbier und Eintopf.







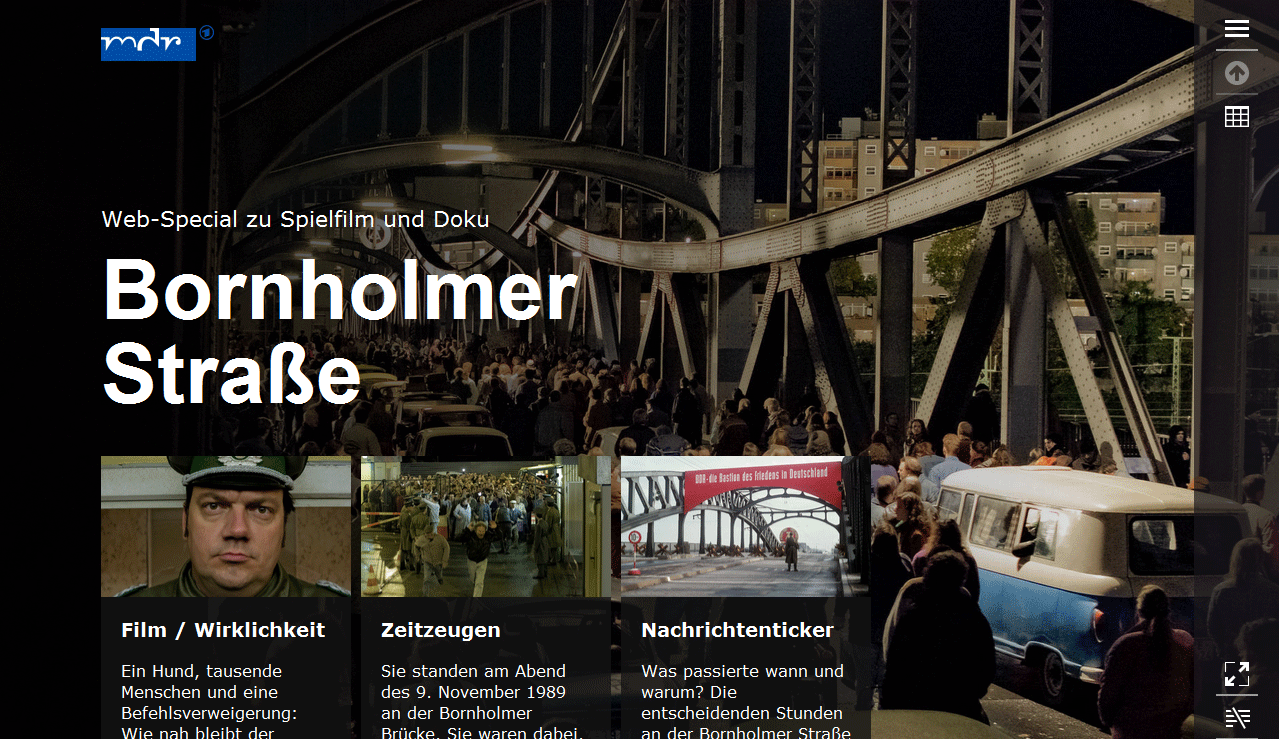

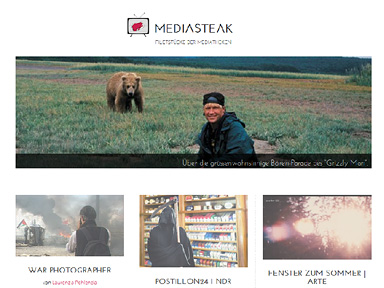




Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!